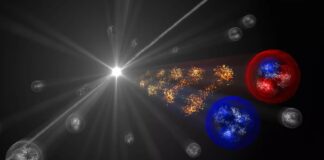Jahrzehntelang näherte sich die Neurowissenschaft dem Gehirn wie die Blinden, die einen Elefanten untersuchen: Sie konzentrierten sich auf einzelne Teile, ließen aber das größere, integrierte Ganze außer Acht. Frühe Forschungen behandelten Gehirnregionen als isolierte Spezialisten – die Amygdala für Emotionen, den Hinterhauptslappen für das Sehen – oft basierend auf dramatischen Fallstudien wie Phineas Gage, dessen Persönlichkeitsveränderung nach einer Hirnverletzung die Bedeutung des Frontallappens festigte. Aber diese fragmentierte Sicht war unvollständig.
Der Aufstieg des Netzwerkdenkens
Der Durchbruch gelang Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre mit Fortschritten bei bildgebenden Verfahren des Gehirns wie funktionellen MRT- und PET-Scans. Mit diesen Werkzeugen konnten Wissenschaftler das gesamte Gehirn in Aktion beobachten und eine verblüffende Wahrheit ans Licht bringen: Keine Gehirnregion arbeitet isoliert. Komplexe Verhaltensweisen entstehen durch synchronisierte Aktivitäten über mehrere, überlappende Netzwerke hinweg.
Wie Luiz Pessoa von der University of Maryland es ausdrückt: „Die Kartierung von Gehirnnetzwerken hat eine wichtige Rolle bei der Veränderung des neurowissenschaftlichen Denkens gespielt.“
Das Standardmodus-Netzwerk und darüber hinaus
Der moderne Wandel begann im Jahr 2001, als Marcus Raichle das Default Mode Network (DMN) identifizierte – ein Netzwerk, das aktiv ist, wenn der Geist nicht auf eine bestimmte Aufgabe konzentriert ist. Weitere Untersuchungen zeigten, dass sich das DMN beim Tagträumen und bei der Selbstreflexion verstärkt. Diese Entdeckung lieferte eine entscheidende Grundlage für die Messung aller Gehirnaktivitäten.
Bald darauf entstanden weitere Schlüsselnetzwerke, die jeweils für Funktionen wie Aufmerksamkeit, Sprache, Emotionen, Gedächtnis und Planung verantwortlich sind. Diese ganzheitliche Sichtweise veränderte das Verständnis neurologischer und psychischer Erkrankungen. Netzwerkunterschiede werden mittlerweile mit Parkinson, posttraumatischer Belastungsstörung, Depression, Angstzuständen und sogar ADHS in Verbindung gebracht.
Von Autismus bis Alzheimer: Ein vernetzter Ansatz
Die Netzwerkwissenschaft hat sich zu einem eigenständigen Fachgebiet entwickelt. Autismus wird zunehmend als eine Variation innerhalb des sozialen Salienznetzwerks verstanden, das bestimmt, wie wir soziale Signale wahrnehmen und darauf reagieren. Die Alzheimer-Forschung legt nun nahe, dass sich abnormale Proteine entlang der Netzwerkpfade ausbreiten. Die Prinzipien neuronaler Netze haben sogar die Entwicklung von KI-Systemen wie ChatGPT inspiriert.
„Vielleicht sehen wir noch nicht den ganzen Elefanten, aber das Bild wird auf jeden Fall klarer.“
Dieser Paradigmenwechsel ist nicht nur akademisch. Neuronale Netze haben die Art und Weise, wie wir hirnbezogene Störungen diagnostizieren und behandeln, erheblich verbessert. Indem wir das Gehirn als dynamisches, miteinander verbundenes System erkennen, gehen wir über lokalisierte Lösungen hinaus und gehen auf die grundlegenden Muster von Funktionsstörungen ein. Der Fokus liegt nicht mehr darauf, wo etwas passiert, sondern wie alles zusammenhängt.